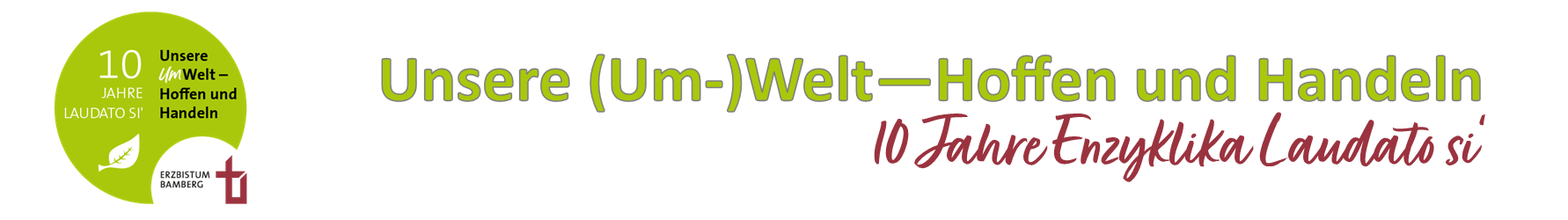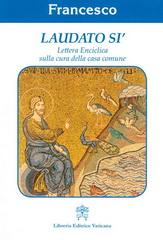Am 18. Juni 2015 (datiert auf den 24. Mai 2015 – Pfingsten) wurde die Enzyklika „Laudato si'“ (Gelobt seist du) von Papst Franziskus veröffentlicht. Franziskus bezieht sich damit explizit auf den „Sonnengesang“ bzw. „Lob der Schöpfung“ des Hl. Franz von Assisi (verfasst um 1224/1225).
Diese deutliche Bezugnahme und der Untertitel „Über die Sorge für das gemeinsame Haus“ weisen darauf hin, dass es Franziskus in diesem Schreiben zentral um den „Haushalt Gottes“, um das gemeinsame „Lebenshaus Erde“ geht.
Dabei wäres es falsch, „Laudato si'“ als reine Klima- oder Ökoenzyklika zu betrachten. Es handelt sich zwar um das erste päpstliche Rundschreiben, das ausführlich das Mensch-Natur-Verhältnis in den Blick nimmt. Dies geschieht jedoch immer im Zusammenhang mit sozialen Problemen. Es handelt es sich daher um eine Sozial- und Umweltenzyklika.
Der Text der Enzyklika ist auf den Seiten des Vatikan (html) zu finden oder kann bei der Deutschen Bischofskonferenz bestellt werden bzw. steht dort zum Download (pdf) zur Verfügung.
Radio Vatikan hat darüber hinaus auch eine Zusammenfassung des durchaus langen Textes verfasst sowie einen knappen Leseschlüssel zur Verfügung gestellt, der einige Grundanliegen der Enzyklika benennt.
Laudato si' - Aufruf zu einer äußeren und inneren Umkehr
Mit der Enzyklika „Laudato Si’. Über die Sorge für das gemeinsame Haus“ hat Papst Franziskus im Juni 2015 ein Rundschreiben veröffentlicht, das den Lebensstilwandel zu einem Grundsatzprogramm christlichen Lebens erhebt.
Mit dem Titel „Laudato Si’“ – „Gelobt seist du“ nimmt der Papst Bezug auf den heiligen Franz von Assisi, der mit diesen Worten seinen berühmten „Sonnengesang“ beginnen ließ. Die Rede vom „gemeinsamen Haus“ im Untertitel spielt zum einen mit der griechischen Wurzel moderner Fremdwörter wie Ökologie und Ökonomie (oikos = Haus, Haushalt) und meint zum anderen im übertragenen Sinn den „Haushalt Gottes“, das „Lebenshaus“ Erde, in dem wir alle gemeinsam mit allen Geschöpfen „wohnen“. Dem Papst geht es also in diesem Lehrschreiben um eine ausführliche Betrachtung des Verhältnisses von Mensch und Natur aus christlicher Perspektive.
Dabei ist Laudato Si’ keineswegs eine reine Umwelt- oder gar Klimaenzyklika: Vehement betont der Papst den oft engen Zusammenhang zwischen einem fragwürdigen Umgang mit der Schöpfung und sozialen Problemen innerhalb menschlicher Gesellschaften und fordert daher das Denken im Rahmen einer „ganzheitlichen Ökologie“. Er stellt sich damit explizit in die Tradition des Konzepts einer nachhaltigen Entwicklung der ganzen Menschheit (siehe Beitrag Nachhaltigkeit).
Zugleich greift Franziskus auf seine lateinamerikanischen Wurzeln zurück, indem er befreiungstheologische Impulse wie die Betonung der biblischen Forderung nach einem befreiten Leben für alle aufnimmt. Davon ausgehend tritt er insbesondere für eine umfassende „Option für die Armen“ ein – und „unter den am meisten verwahrlosten und misshandelten Armen“ befindet sich „diese unsere unterdrückte und verwüstete Erde“ (LS 2). Auf dieser Grundlage rechnet der Papst mit der modernen Kultur ab, ihrem „Fortschrittsmythos“, ihrem Glauben an grenzenloses Wachstum und die Selbstregulierungskräfte von Marktmechanismen. Er ruft auf zu einer „mutigen kulturellen Revolution“ (LS 114), zum Widerstand gegen den „Konsumismus“ (LS 203) und gegen „soziale Ungerechtigkeit“ (LS 51, 158).
Für dieses Ziel wendet sich Franziskus an jeden Menschen, „der auf diesem Planeten wohnt“ und ruft dazu auf „die gesamte Menschheitsfamilie in der Suche nach einer nachhaltigen und ganzheitlichen Entwicklung zu vereinen“ (LS 13). Dazu brauche es sowohl einen verstärkten Einsatz von Wirtschaft und Politik für einen „Dienst am Leben“ wie auch ein verstärktes Verantwortungsbewusstsein des Einzelnen. Der Papst betont daher explizit die Bedeutung eines verantwortungsvollen Lebensstils sowie einer Umwelterziehung auch und gerade in den Familien. Die christliche Spiritualität könne hierfür als Quelle dienen, schlage sie doch „ein anderes, bescheideneres Verständnis von Lebensqualität vor“ und führe zu „Genügsamkeit und Demut“ (LS 224), zu einem „Weniger ist mehr“ (LS 222).
Franziskus verlangt von uns also nicht wenig in diesem Schreiben: einen radikalen gesellschaftlichen Umbau hin zu nachhaltiger Entwicklung, eine Veränderung des persönlichen Lebensstils und ein deutliches Zurückschrauben materieller Ansprüche sowie nicht zuletzt eine erneuerte Spiritualität, eine Gottesbeziehung, die uns unser Verhältnis zur Schöpfung grundsätzlich neu denken lassen soll (siehe Beiträge gutes Leben und Schöpfungsspiritualität). Die Größe dieser Aufgabe muss uns aber nicht in Resignation stürzen. Denn Franziskus vermittelt bei aller Beschreibung von Problemen und Herausforderungen immer die Hoffnung, dass diese Veränderung der Weichenstellung in der menschlichen Entwicklung gelingen kann und dass dies nicht nur mühsames Verzichten und eine Verringerung unserer Lebensqualität bedeutet, sondern einfach ein „Anders besser leben“.